Da sitzt das Kind versunken in sein Tun im Sand auf dem Spielplatz. Immer wieder lässt es den Sand ganz langsam aus der Höhe in von einer kleinen Schaufel in den Eimer rieseln. Die Hälfte des Sandes geht dabei daneben, aber das Kind macht unbeirrt weiter und rieselt vor sich hin. Bis zu dem Moment, an dem der Vater eingreift: „Schau mal, so geht doch alles daneben. Du musst die Schaufel tiefer halten, dann geht der ganze Sand auch in den Eimer.“ – Das Kind blickt auf. Ein lieb gemeinter Vorschlag des Vaters. Es lässt die Schaufel sinken. Der Vater nimmt sie, schaufelt den Eimer voll, drückt den Sand fest, kehrt den Eimer um und entleert ihn. Der Sandkuchen ist fertig, das Kind steht auf und geht zur Rutsche. Eine Szene, die nicht selten zu sehen ist und die auf viele andere Situationen übertragen werden kann: Das Kind spielt, Erwachsene bewerten das Spiel, greift ein, das Kind beendet das Spiel. Auch wenn das Eingreifen des Elternteils hilfreich und unterstützend gemeint ist an dieser Stelle, ist es ein Eingriff in das selbständige Erkunden.
Selbständig die Welt entdecken
Kinder sind neugierig und die Neugierde ist der Motor ihrer Entwicklung. Durch sie lernen Kinder die Welt kennen, interagieren mit ihr, stellen die Dinge in Frage und machen Erfahrungen. Sie lernen Zusammenhänge, Ursache-Wirkung und machen Fehler, aus denen sie wieder etwas lernen. Dafür brauchen sie die Möglichkeit, Erfahrungen ungestört machen zu können. Als Eltern verfügen wir selbstverständlich über viel mehr Erfahrung, haben schon viel erlebt und selber Fehler gemacht, aus denen wir gelernt haben. Um unsere Kinder vor diesen Fehlern zu bewahren, um sie zu bilden und zu unterstützen, sind wir machmal verleitet, in ihr Tun einzugreifen. Doch das Tun der Kinder ist wichtig für ihre Entwicklung.
Lassen wir das Kind tun, was es gerade machen möchte: balancieren lernen in einer noch sicheren Höhe, physikalische Experimente mit Wasser und Sand, Mengenexperimente durch das Schütten von einem Becher in den anderen, Steine stapeln, die immer wieder herunterfallen… Auch wenn das Ergebnis nicht unseren Vorstellungen entspricht, lernen Kinder davon: Sie lernen, ausdauernd bei einer Aktivität zu bleiben, sie lernen Konzentration, sie lernen Selbstvertrauen und sind stolz auf sich, wenn sie ihr eigenes Ziel erreicht haben. Wenn es nicht klappt, lernen sie, mit der Frustration umzugehen. Sie fühlen sich kompetent, wenn sie etwas machen dürfen und nicht von Erwachsenen darin unterbrochen werden, weil sie es scheinbar besser können. Sie lernen um Hilfe zu bitten, wenn sie Hilfe wirklich benötigen.
Unterbrechen wir das Spiel des Kindes, weil wir es scheinbar besser wissen, lernen die Kinder bestensfalls unseren Weg kennen. Schlechtestenfalls fühlen sie sich unterlegen, inkompetent und verlieren Vertrauen in ihr eigenes Tun. Sie geben das Explorieren auf und werden darauf angewiesen, „unterrichtet“ zu werden statt zu erkunden.
Statt eingreifen: Die Haltung der passiven Teilnahme
Lassen wir also unsere Kinder aktiv sein und die Welt bis zu dem Grad, an dem wir aus Schutz eingreifen müssen, selbst erkunden. Viele Kinder brauchen dennoch Erwachsene als sicheren Hafen im Hintergrund: Eltern, die anwesend sind, aber nicht eingreifen in das Spiel oder Erkunden. Die nicht beobachten, aber im Notfall zur Seite stehen. Diese Haltung der passiven Teilnahme gibt uns Eltern zugleich Raum, anderen Tätigkeiten in der Nähe nachzugehen. Es reicht für viele Kleinkinder aus, dass die Eltern in sicht- und hörbarer Nähe sind, damit sie in ein Spiel und Erkunden versinken können. Gelegentlich tauchen sie aus der Erkundung auf, um Nähe einzufordern: durch Körperkontakt, durch Sprache, manchmal auch nur durch einen Blick. Im Anschluss können sie, sicher in dem Gefühl, dass die vertraute Person da ist und im Notfall zur Verfügung steht, wieder in das Spiel eintauchen.
Braucht das Kind dann doch Hilfe und Unterstützung, kann es diese selbst einfordern. Aber auch dann müssen wir als Eltern nicht den richtigen Weg vorgeben, sondern können dem Kind helfen, sich selbst zu helfen: Wir können eine Idee geben, eine Anregung. Und dem Kind die Möglichkeit überlassen, von da an den Weg selbst zu finden oder nach weiterer Hilfe zu fragen.
Lassen wir unseren Kindern die Chance, die Welt nicht nur aus ihren Augen zu sehen, sondern auch mit ihren Händen und Ideen zu entdecken.
Eure
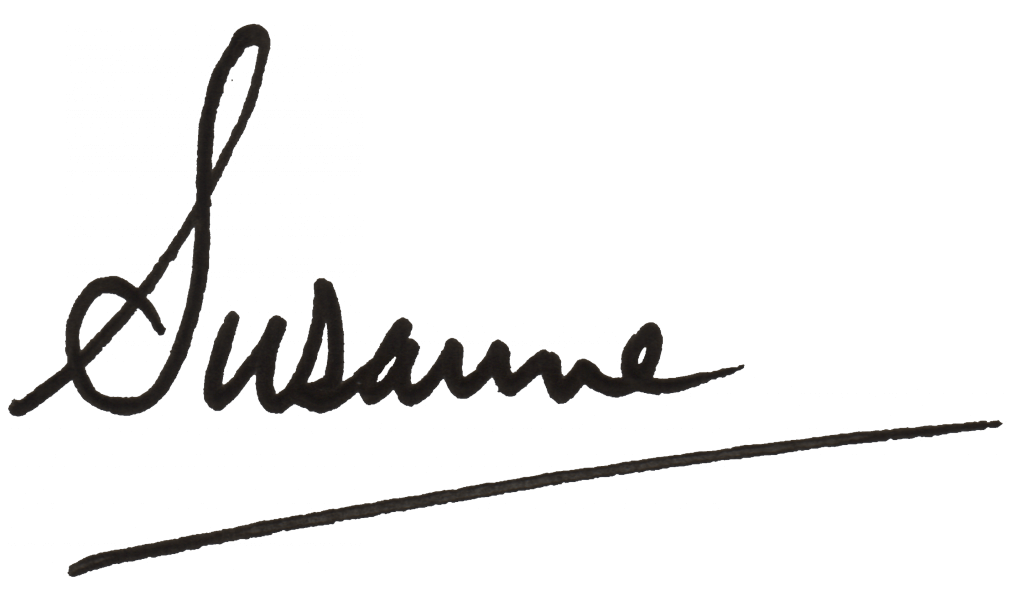
Zur Autorin:
Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin (Schwerpunkt Kleinkindpädagogik) und Familienbegleiterin. Sie arbeitete an der FU Berlin in Forschung und Lehre, bevor sie sich 2011 im Bereich bedürfnisorientierte Elternberatung selbständig machte. Ihr 2012 gegründetes Blog geborgen-wachsen.de und ihre Social Media Kanäle sind wichtige und viel genutzte freie Informationsportale für bedürfnisorientierte Elternschaft und kindliche Entwicklung. Susanne Mierau gibt Workshops für Eltern und Fachpersonal und spricht auf Konferenzen und Tagungen über kindliche Entwicklung, Elternschaft und Familienrollen.
Foto: Susanne Mierau für geborgen-wachsen.de


